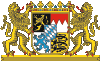Beispielgebende Projekte
Voneinander lernen und daraus eigene Projektideen entwickeln
Gewinnen Sie aus erfolgreichen Projektbeispielen neue Ideen, um daraus innovative eigene Projekte zur Stärkung des ländlichen Raumes in Oberfranken zu entwickeln. Unser Amt bietet Ihnen dazu beispielgebende Projekte, die ausgezeichnet wurden oder Ihnen unsere Möglichkeiten zur nachhaltigen Entwicklung der oberfränkischen Regionen, Dörfer und Landschaften aufzeigen. Alle vorgestellten Projekte haben gemeinsam, dass Sie die von Bürgerinnen und Bürgern sowie den Kommunen erarbeiteten Ziele wiedergeben. Eine erfolgreiche Umsetzung war vielfach erst mit den Möglichkeiten des Bodenmanagements möglich.
Kasberg
Die Talente des Baubestands nutzen - Alte Hofstelle wird zu Wohnraum und Café

Bei diesem Projekt im Landkreis Forchheim bedeutet „Dorferneuerung“ primär die Alltagsnutzung in das Dorf zurückzubringen und „Baukultur“ die versteckten Talente des Baustandes zu entdecken, freizulegen und zu bewirtschaften. Der Transformationsprozess wird geprägt von neuen Wohnungen und Bewohnern, aufgewerteten Freiräumen, gesicherten historischen Bauwerken und nicht zuletzt mit dem Café Kunni. Aus großen Leerstandsgebäuden entstand ein attraktiver Anlaufpunkt für die Dorfbevölkerung, der sich nahtlos in das oberfränkische Dorf einfügt.
Meierhof
Alte Qualitäten wiederentdeckt - Behutsamer Umbau einer Schule zum Gemeinschaftshaus

Das ehemalige Dorfschulhaus in Meierhof im Landkreis Hof aus dem Jahr 1867 erhält mit dem Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus seinen ortsbildprägenden Wert zurück. Der ursprüngliche Charakter des Gebäudes wurde durch die Erhaltung und Neuinterpretation zurückgewonnen und die ehemaligen Nutzungen der Innenräume erfahrbar gemacht. Das Dorfgemeinschaftshaus wird heute durch zeitgemäße soziale und kulturelle Nutzungen wie Bürgerworkshops und Vereinstreffen belebt und ist ein neuer Mittelpunkt des Ortes.
Feilitzsch
Vom Kuhstall zum Dorfladen

Die Belebung der Dorfmitte war bereits von 2004 bis 2016 zentraler Bestandteil der Dorferneuerung Zedtwitz. 2018 ergab eine Bürgerbefragung, dass sich die Zedtwitzer dringend eine fußläufige Einkaufsmöglichkeit, aber auch einen Treffpunkt im Dorf wünschen. In einem leerstehenden Dreiseithof entstand mit dem ZEDTkauf der neue Dorfladen sowie das moderne Café Gerdi. Das Projekt sichert die Daseinsvorsorge für den täglichen Bedarf, fördert die regionale Wertschöpfung und stärkt den sozialen Zusammenhalt.
Carlsgrün
Eine moderne Ortsmitte mit einheimischen Materialien

Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses mit Feuerwehrhaus stärkt die Qualität des zentralen historischen Dorfangers. Er ist Treffpunkt für Jung und Alt und stellt somit einen bedeutenden Beitrag für die Innenentwicklung von Carlsgrün dar. Mit der Baumaßnahme fand das städtebaulich störende alte Feuerwehrhaus einen neuen und passenderen Standort. Der Gemeindesaal wird multifunktional von der Feuerwehr, den örtlichen Vereinen und der Dorfgemeinschaft genutzt.
Flurneuordnung Oberfränkischen Jura - Fesselsdorf, Modschiedel, Seubersdorf, Weiden, Zultenberg
Lebensraum für die Feldlerche - Artenschutz und Landwirtschaft Hand in Hand

Die Landschaft um Zultenberg bietet sehr gute Lebensbedingungen für die Feldlerche. Um nach der Zusammenlegung der Felder den Bestand der Feldlerche zu erhalten, entwickelten Landwirte und Biologen ein Konzept, das die Ansprüche der modernen Landwirtschaft und des Naturschutzes verbindet. Zählungen bestätigen den Erfolg. Die Erkenntnisse konnten auf angrenzende Verfahren erfolgreich übertragen werden.
Dorferneuerung Niederlamitz
Der Holzbau einer Festscheune schafft neue baukulturelle Qualität auf historischem Gelände

Mit der Revitalisierung des ehemaligen Geländes des Niederlamitzer Hammers wird die industrielle und wirtschaftliche Vergangenheit des Fichtelgebirges wieder erlebbar. Das attraktive Freizeitgelände eröffnet den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Aktionen. Das Projekt leistet einen hervorragenden Beitrag zur regionalen Baukultur und zum Klimaschutz.
Dorferneuerung Witzmannsberg
Umbau und Sanierung des ehemaligen Freizeitzentrums zu einem Bürger- und Kulturzentrum

Das ehemalige Freizeitzentrum mit Schwimmhalle ist ein typisches Beispiel für ein Funktionsgebäude der späten 70er-Jahre und wurde in Betrieb und Unterhalt für die Gemeinde Ahorn seit vielen Jahren zur Belastung. Teilabbruch und energetische Sanierung zeigen beispielhaft, wie Bausubstanz aus dieser Zeit einer nachhaltigen Nutzung zugeführt werden kann.
Dorferneuerung Bad Alexandersbad
Den historischen Kurort in die Zukunft geführt

Mit einem innovativen Bürgermeister an der Spitze, begann die Dorferneuerung, die Bad Alexandersbad das zurückgab, was über Jahre verloren ging. Zusammen mit der Städtebauförderung wurde das Kurmittelhaus unter Einbindung des historischen Alten Kurhauses modernisiert und der Kurplatz wiederhergestellt. Ein umfassendes Energiekonzept wurde umgesetzt. Das sind die weithin sichtbaren Ergebnisse der Arbeit, aber die eigentlichen Errungenschaften der Dorferneuerung zeigen sich in der Gemeinschaft der Bürger.
Dorferneuerung und Flurneuordnung Klosterlangheim
Ein Jahrhunderte altes Konzept der Klosterlangheimer Mönche: Historie als Vorbild für modernen Hochwasserschutz

Klosterlangheim wird auch heute noch geprägt von Teilen der historischen Bauten des in der Säkularisation aufgelösten Zisterzienserklosters Langheim. Und ebenso wie die Mönche des damaligen Klosters müssen sich auch die Bewohner der heutigen Ortschaft mit dem Wasser auseinandersetzen, das oft über die Ufer der Leuchse und ihrer Zuflüsse tritt. Bei der Suche nach Lösungen erinnerte man sich wieder an das ausgeklügelte Hochwasserschutzsystem der Mönche vor fast einem Jahrtausend, das aber zu großen Teilen wieder verloren gegangen war.